Umfrage
Künstliche Intelligenz (KI), also u.a. selbstlernende Computer, begleitet den Menschen heute in sehr vielen Lebenslagen. Sprachassistenten helfen beim Einkauf und spielen den gewünschten Musiktitel ab. Haushaltsroboter erleichtern den Alltag, Autos parken selbstständig ein.
Vor allem der Bereich der digitalen Sprachassistenten ist in Bewegung: Menschen kommunizieren nicht nur mehr mit einem Computer-Betriebssystem wie Windows oder iOS, sondern auch mit digitalen Begleitern wie Siri oder Alexa. Künstliche Intelligenz kann Dinge mit hoher Geschwindigkeit erledigen, die Menschen nicht beherrschen oder die ihnen schwerfallen. Sie ist ein praktisches Hilfsmittel, das durch Übernahme von Routineaufgaben den Alltag der Menschen erleichtern kann. Und zusätzlich kann man ohne großen Aufwand auf ein umfangreiches Wissen zurückgreifen.
Aber Künstliche Intelligenz ist immer nur dann erfolgreich, wenn die Lösungen einer Aufgabe eindeutig sind. Denn intelligente Computerprogramme müssen trainiert werden, um intelligent zu sein. Sie müssen wissen, ob das errechnete Ergebnis das richtige ist. In der Medizin werden intelligente Systeme beispielsweise für bildgestützte Diagnoseverfahren eingesetzt. Mit KI-Systemen, die mit großen Bild-Datenbanken trainiert wurden, lassen sich bereits erfolgreich Vorhersagen zur Bösartigkeit von Tumoren erstellen. Andere selbstlernende Systeme können herausfinden, ob bestimmte Beschwerden Symptome für eine schwerwiegende Erkrankung sind. Die Hoffnung vieler Mediziner: KI ermöglicht schnelle und genaue Befunde. Ärzte können sich durch die Zeitersparnis intensiver dem Patienten widmen.
Anders verhält es sich, wenn eine Frage oder Aufgabe keine einfache Antwort zulässt. Können Maschinen zum Beispiel besser Auto fahren? Wenn sich die Antwort auf die Einhaltung von Regeln im Straßenverkehr und eine unfallfreie Fahrt beschränkt, könnte ein Autopilot durchaus besser sein. Jedoch treffen Maschinen andere Entscheidungen als menschliche Autofahrer, die neben logischen auch emotionalen und moralischen Grundsätzen folgen. Dies führt zu ethischen Fragestellungen, die bisher nicht geklärt sind.
Es ist nicht verwunderlich, dass viele Menschen selbstlernenden Computern kritisch gegenüberstehen. "Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz könnte entweder das schlimmste oder das beste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein", sagte der britische Astrophysiker Stephen Hawking. Seiner Meinung nach könnten Computer der menschlichen Intelligenz nacheifern und sie sogar übertreffen. Sie könnten einen eigenen Willen entwickeln.
Zudem verbergen sich hinter den Ergebnissen, die KI-Technologien liefern, Big-Data-Analysen. Nahezu jede Aktion eines Nutzers im digitalen Raum ist mit dem Sammeln und Verarbeiten von Daten verknüpft. Täglich entstehen riesige Datenmengen, die von Herstellern, Dienstleistern, Banken, Versicherungen, Arbeitgebern, Wissenschaftlern und Ermittlungsbehörden für ihre eigene Arbeit genutzt werden.
Kritik an der Künstlichen Intelligenz entsteht auch dadurch, dass die Funktionsweisen von Algorithmen für viele Menschen nicht verständlich sind. Selbst Wissenschaftler wissen nicht immer genau, wie selbstlernende Computer ihre Strategien entwickeln und was sie als nächstes tun werden.
Das bereitet den Menschen Sorgen: Werden wir überhaupt noch verstehen, wie eine Künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft? Dass eine KI ein Geheimnis haben kann, bewiesen die beiden Netzwerke „Alice“ und „Bob“. Es ist darum eine Aufgabe der Wissenschaft, nicht nur intelligente Systeme zu erschaffen, sondern auch die nötige Transparenz für ihre Funktionsweise zu entwickeln.
 Immer mehr Menschen nutzen Künstlichen Intelligenz. Aber nur wenige wissen genau, was KI genau ist.
Was ist Künstliche Intelligenz?
Immer mehr Menschen nutzen Künstlichen Intelligenz. Aber nur wenige wissen genau, was KI genau ist.
Was ist Künstliche Intelligenz?
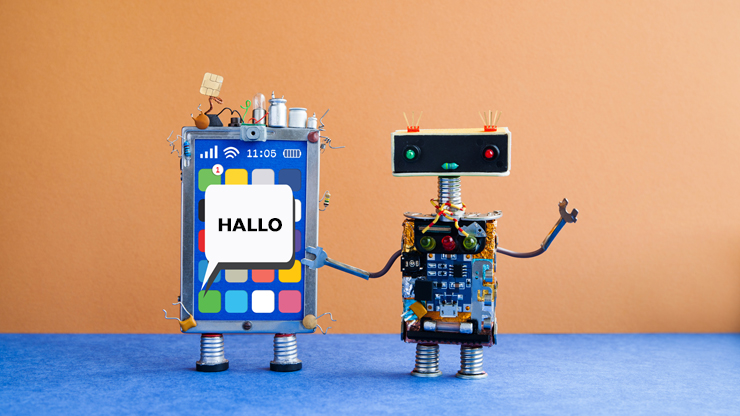 Digitale Assistenten hören dank Spracherkennung aufs Wort und haben das Potential, den Alltag enorm zu erleichtern.
Digitale Assistenten
Digitale Assistenten hören dank Spracherkennung aufs Wort und haben das Potential, den Alltag enorm zu erleichtern.
Digitale Assistenten
Prof. Dr. Oliver Bendel im Interview
Neuigkeiten

Smart Schools gesucht: Wie digitale Bildung Zukunft möglich macht
„Taschengeld-Treffen“: Wenn Online-Angebote Kinder in Gefahr bringen
Wie viel ist zu viel? Wenn Medienerziehung zur Herausforderung wird
Tipp
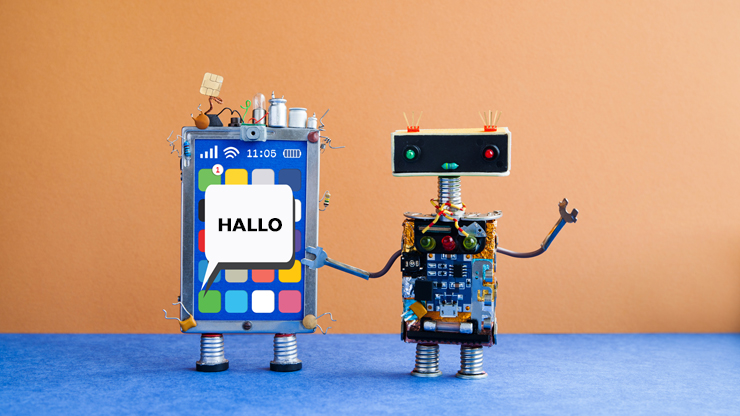
Big Data

Datenschutz

